Sushi besteht, so wie wir das Gericht heute kennen, aus gesäuertem Reis, Fisch, Gemüse, Nori und einigen würzenden Zutaten wie beispielsweise Wasabi und Sojasoße.
Das war jedoch nicht immer so: Ursprünglich war das Einlegen von Fisch in gekochtem Reis einfach nur eine Methode, den Fisch kontrolliert zu fermentieren und so haltbar zu machen.
Der Reis wurde nicht gegessen, der Fisch erinnerte im Aroma in etwa an ordentlich gealterten Käse.
Sushi hat sich über zwei Jahrtausende zu dem entwickelt, was wir heute als Sushi kennen – und im 20. Jahrhundert verlief diese Entwicklung besonders schnell. Schauen wir uns zumindest einige der Zutaten doch einfach genauer an.
Reisanbau als Kulturgut
Wann und wo genau Reis zum ersten Mal kultiviert wurde, ist bis heute nicht klar. Fakt aber ist: Bis auf eine einzige in Afrika gegessene Art des Reises gehören alle heute gegessen Arten von Reis zur Art Oryza sativa. Und die wurde ein einziges Mal kultiviert, vermutlich vor mindestens 8.200 Jahren im Gebiet des heutigen China. Man verortet diese eine, ursprüngliche Domestikation im Gebiet des Perlfluss-Deltas. Von dort aus verbreitete sich der Reis als kultivierte Pflanze für Nahrung zuerst in China, von dort aus später nach Südostasien und nach Indien.
Reisanbau erst seit circa 300 v.Chr. in Japan
Nach Korea kam der Reisanbau und das damit verbundene Wissen vermutlich um das Ende des 2. Jahrtausends vor Christus, nach Japan spätestens um das Jahr 300 vor Christus. Reis-Phytolithen wurden in der Keramik der mittleren Jōmon-Zeit gefunden. Tatsächlich identifizierte Reiskörner stammen allerdings aus der späten Jōmon-Zeit um etwa 1.000 bis 800 vor Christus. Vermutlich nahm der Reis den Weg über das heutige Korea nach Japan, aber auch das ist nicht ganz sicher.
In der Jōmon-Zeit bedeutete Reisanbau in der Regel Trockenfelder. Der Nassreisanbau war vermutlich ab etwa 10.000 vor Christus in China üblich, aber in Japan kennen wir die frühesten Reisfelder dieser Art aus den Jahren um 300 vor Christus. Belegt und datiert sind beispielsweise Felder in Itazuke auf Kyushu (vgl. https://antikewelt.de/2021/09/16/die-zeit-des-wandels-die-yayoi-zeit-in-japan/).
Zu dieser Zeit nutzte man in Japan natürliche Feuchtgebiete, der Reisanbau wurde ausgehend vom Süden bis in den Norden bekannt. Mehr als 200 Fundstellen von Reisfelder aus dieser Epoche sind heute zwischen Kyushu und Sunazawa und Tareyanagi (Aomori) bekannt.
Mit dem Reis kamen Werkzeuge und Siedlungen
Der Reis kam nicht alleine: Neue Techniken in der Keramikherstellung und der Bearbeitung von Werkzeug kamen ebenfalls zu dieser Zeit nach Japan. Die Menschen ließen sich nun in Siedlungen nieder und gaben ihre vorher jahreszeitlich nomadische Lebensweise weitgehend auf. Mit dem Reis veränderte sich das Leben in Japan also grundlegend.
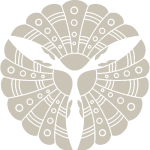
Reis und Shintō: über die besondere Bedeutung von Reis in Japan
Wenn man bedenkt, wie tiefgreifend die Veränderungen sind, mit denen der Reisanbau in deinen Anfängen einherging, verwundert es nicht, dass die kulturelle Bedeutung von Reis weit über die eines blossen Nahrungsmittels unter vielen hinausgeht. Einmal mehr erweist sich die besondere, isolierte Insellage und zerklüftete Geographie Japans als eine Schnittstelle, an der sich die Besonderheiten der japanischen Küche Washoku herausgebildet haben.
Jeder Japaner weiss, dass in jedem Reiskorn sieben Gottheiten leben
Bis heute sät der Kaiser selbst im Palastgarten Reis aus, pflanzt die Setzlinge in eigens dafür im Palastgarten vorbereitete Beete und erntet den Reis selbst. Die Verkostung des neuen Reises ist ein alljährliches Fest, das auf die ältesten mythologischen Erzählungen Japans zurückgeht. Die ersten Reispflanzen sollen aus dem Körper der sterbenden Nahrungsgöttin selbst entstanden sein, als die Götter noch auf der Erde wandelten. Und bis heute weiß der Volksglaube, dass in jedem einzelnen Reiskorn sieben Gottheiten residieren.
Wie die Götter im Reis heissen, weiss jedoch niemand...
Der in Japan weit verbreitete Shintoismus (in Japan existieren Buddhismus und Shintoismus ja parallel, nicht gegenseitig exklusiv) geht davon aus, dass alle Dinge beseelt sind, also mit einem denkenden Wesen versehen. Das gilt für Steine, Berge, Meeresströmungen und Bäume genauso wie für einen in die Jahre gekommen Regenschirm, zerschlissene Hausschuhe und eben Reis.
Warum es ausgerechnet sieben Kami-sama, also Gottheiten, sein sollen, die in jedem einzelnen Reiskorn angesiedelt sind, ist nicht ganz klar. Aber auch die Glücksgötter Japans, nachweislich seit der Muromachi-Zeit (1477-1573) im Volksglauben verankert, sind sieben an der Zahl. Im Gegensatz zu diesen sind die Myriaden von Gottheiten, die in einem Sack Reis ihr Zuhause haben, jedoch namenlos. Warum das so ist, weiss niemand. Aber auch das ist irgendwo typisch japanisch — alles andere wäre zu einfach 😉
Kleine Reiskunde: Die Sorte macht den Geschmack
Heute bedeutet „Sushi“ nicht mehr Fisch, sondern ein Reisgericht, das es wahlweise mit Fisch, mit vegetarischen Zutaten oder sogar mit Fleisch geben kann.
Wichtigste Zutat von Sushi ist „Shari", der mild gesäuerte Reis
Es ist eine Wissenschaft für sich, den Reis mit genau der richtigen Menge an Reisessig, Zucker und Salz zuzubereiten. Der Reis ist so wichtig für Sushi, dass Sushi-Chefs in Ausbildung in Japan erst einmal zwei Jahre lang nur Reis kochen und würzen, bevor sie den Fisch überhaupt anfassen dürfen. Größere Sushi-Bars in Japan beschäftigten früher Angestellte, die sich ausschließlich um den Reis kümmerten.
In Japan (natürlich) nur Reis der Gattung Japonica
In Japan wird ausschließlich Japonica Reis verwendet. Die Reiskörner sind etwas kürzer und rundlicher als beim Indica Reis. Und sie sind klebriger. Sushireis ist Japonica Reis, und zwar meist eine Sorte mit mittellangen Reiskörnern. Das Geheimnis dieses Reises liegt in der Stärke. Denn die besteht jeweils aus Bündeln von unregelmäßig angeordneten Zuckern, meist zwischen 5.000 und 20.000 je Kette. Die molekularen Ketten sind auch nicht regelmäßig angeordnet, sondern sehen eher wie ein stacheliger Haufen aus. Deshalb klebt der Reis. Das Besondere an der bevorzugten Sorte Reis für Sushi ist die Form der Reiskörner: Die sind maximal zwei- oder dreimal so lang wie breit. Diese Form macht es leichter, den Reis in die richtige Form zu pressen, ohne dass er zu einem festen Block wird.
In Japan bevorzugt man die Sorte Koshi-Hikari für Sushi. Dieser Reis enthält auch nach dem Schälen und Polieren noch aromatische Fettsäuren, die dem Reis Geschmack und ein leicht feuchtes Gefühl im Mund verleihen. Besonders hochwertiger Koshi-Hikari darf nach der Ernte in der Sonne trocknen. Kostengünstiger ist der industriell mit heißer Luft getrocknete Reis.
Brauner Reis oder weißer Reis?
Oft liest und hört man, dass der schneeweiß leuchtende, ganz zart duftende japanische Reis eine moderne Sache ist, die es so nur in den wirtschaftlich gut gestellten Haushalten gab. Das gemeine Volk musste jahrhundertelang mit braunem, ungeschältem Reis Vorlieb nehmen. Das ist so nur teilweise korrekt.
Tatsächlich war Reis ohnehin jahrhundertelang den Bessergestellten vorbehalten.
Hirse und Hülsenfrüchte waren dagegen viel stärker verbreitet als heute. Wenn im Volksmärchen Momotarō von Kibi-dango, von Hirsebällchen, die Rede ist, dann ist das durchaus realistisch. Hirse wurde verwendet wie heute Reis. Die gedämpften oder gekochten Samen wurden mit Hülsenfrüchten oder anderen Zutaten versetzt und zu Bällchen gepresst, die unterwegs als Mahlzeit dienten. Das mag mit den heutigen Onigiri vergleichbar sein, minus Nori.
Technische Entwicklung bestimmt, wie weiß der Reis ist
Aber wie sah nun der Reis aus? Der heutige weiße Reis ist ein Produkt hervorragender Technik. Er wird nicht nur geschält und vom Keimling befreit, sondern auch poliert. Damit sind sämtliche dunklen Partikel aus Schale und Keimling wirklich weg. Aber so sauber arbeiten nur die Maschinen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden. Davor drosch man mit hölzernen Werkzeugen auf den Reis ein, um die feinen Körner von ihren harten Schalen zu befreien und genießbar zu machen. Ein Teil der dünnen, ballaststoff- und mineralstoffreichen Schicht unter der Schale blieb am Reiskorn haften und konnte nicht entfernt werden. Und das galt auch für den Reis der höheren Gesellschaftsschichten. Farblich war der Reis also durch den größten Teil der japanischen Geschichte beige bis hellbraun. Heutiger Vollkornreis ist dunkler.
Volkskrankheit Beri-Beri
Mit der Vorliebe zu weißem Reis und dessen Verbreitung in weiten Bevölkerungsschichten verbreitete sich auch eine Krankheit in Japan: Beri-Beri galt lange Zeit als nationales Leiden. Denn beim Polieren verliert der Reis einen Großteil der B-Vitamine. Beri-Beri ist eine Mangelerscheinung.
Aber auch mit dem reinreißen Reis, den wir heute kennen, war Sushi nicht weiß. Denn der Reis wurde lange Zeit fermentiert. Er dunkelte dabei. Sogar Edomae-Sushi, die schnell zubereiteten Nigiri des alten Edo, waren nicht weiß. Denn hier verwendete man zum Säuern des Reises einen rötlichen Reisessig, der kräftiger schmeckt und dem Reis einen zarten rotbraunen Schimmer verleiht.
Geheimnis der Profis: Nikiri
Nicht immer wird Sushi fertig gewürzt serviert. Häufig kommen die einzelnen Häppchen mit einer kleinen Schale brauner Soße zum Gast. Dabei handelt es sich allerdings nicht, wie häufig vermutet wird, um Sojasoße. Sojasoße ist so intensiv im Geschmack, dass sie die komplexen Aromen von Sushi schlicht überdecken würde. Diese geheimnisvolle Soße heißt Nikiri. Die Basis von Nikiri ist wiederum Dashi, die klare Brühe auf der Basis von Fisch und Seetang.
Konbu und Bonito für ATP und IMP
Dashi wird hergestellt, indem 昆布 (Konbu, eine Art von Seetang) und 鰹節 (Katsuobushi, Bonitoflocken) abgekocht werden.
Konbu enthält von Natur aus große Mengen an Glutamat. Das ist der Stoff, der Dashi und damit Nikiri so geschmackvoll macht. Aber es ist nur die Hälfte des Geheimnisses. Die andere Hälfte liegt in der Herstellung der Bonitoflocken.
Bonito ist ein Thunfisch, in seinem Muskelfleisch hohe Mengen an Adenosintriphosphat (kurz ATP) speichert. Für die Herstellung der Flocken wird das Filet des Fischs gekocht und anschließend für zehn bis zwanzig Tage geräuchert. Der Fisch wird mit Schimmel infiziert und für zwei Wochen liegengelassen. Anschließen wird der Fisch in der Sonne getrocknet, der alte Schimmel abgekratzt, neuer Schimmel aufgetragen und der Fisch wieder für mehrere Wochen ruhen gelassen. Das Prozedere wird drei- bis viermal wiederholt. Dabei werden durch Enzyme die Proteine im Fischfleisch in Aminosäuren aufgebrochen. Das ATP insbesondere wird in eine ganze Reihe anderer Moleküle zerlegt. Darunter ist auch Inosin-Monophosphat, kurz IMP. Darauf reagieren die menschlichen Geschmacksnerven genauso wie auf Glutamat.
Nach einigen Wochen Trocknen und Schimmelbehandlung ist das Bonitofilet hart wie ein Stück Holz. Mit dem Hobel werden feine Späne oder Flocken davon abgenommen. Das ist Katsuobushi, wieder ein Zutat, die eng mit der spezifischen Region Japan verbunden ist, die an allen Ecken in der japanischen Küche auftaucht und immer mehr Beachtung bei Sterneköchen in aller Welt findet. Übrigens das auch ein Grund, warum japanische Küche ganz selten „rein“ vegetarisch ist: weil fast überall Katsuobushi als eine Art Grundstock mit drin ist.
Genaue Mengen sind Geheimsache
Dashi ist die Grundzutat für Nikiri. Auch Sojasoße, Sake und Mirin werden dazugeben. Jeder Sushi-Chef hat seine eigene geheime Rezeptur für Nikiri. Das Standardrezept sieht allerdings 100 Teile Sojasoße, 20 Teile Dashi, 10 Teile Sake und 10 Teile Mirin vor.
Während man heute Nikiri bisweilen anstelle von Sojasoße zur Sushi gereicht bekommt, trägt ein traditioneller Sushi-Chef Nikiri zart mit dem Pinsel auf, bevor das einzelne Stück Sushi an den Gast herausgegeben wird.
Sojasoße als Beiprodukt der Miso-Produktion
Abgesehen davon, dass jede gelungene japanische Mahlzeit mit einer kleinen Schale Misosuppe erst vollendet ist, hat Miso erst einmal nichts mit Sushi zu tun. Indirekt aber schon. Denn Sojasoße ist ein Nebenprodukt der Miso-Produktion.
Auch Miso ist ein fermentiertes Nahrungsmittel
Miso wird auf der Basis von Sojabohnen hergestellt.
Bevor es aber um die Sojabohnen geht, wird Reis in größeren Mengen mit dem Schimmelpilz 麹 (kōji, Aspergillus oryzae) infiziert. Sowie der Pilz den gesamten Reis durchsetzt hat, werden gekochte Sojabohnen und etwas Salz dazugegeben. In der industriellen Herstellung kommen auf 6.600 Pfund Reis 5.000 Pfund Sojabohnen. Bakterien und Hefen werden ebenfalls ergänzt.
Während die Enzyme des Kōji die Proteine in Reis und Sojabohnen zu handlichen Aminosäuren aufbrechen, und die Kohlenhydrate in einfache Zucker zerlegen, stirbt der Kōji aufgrund von Sauerstoffmangel schnell ab.
Die Glukose und Zucker werden von den Bakterien in Milchsäure und Essigsäure umgewandelt. Auch die Hefekulturen mögen Zucker, sie setzen ihn in Alkohol um. Der Alkohol wiederum reagiert mit den Säuren, die die Bakterien produziert haben, zu fruchtigen Estern.
Diese Aromen kennen wir nicht nur aus Miso, sondern finden sie auch in einem guten Wein. Wenn Kōji, Bakterien und Hefen ihre Arbeit vollbracht haben, ist aus der Mischung von Reis und Sojabohnen Miso geworden.
Miso ist sehr reich an natürlichem Glutamat.
Sojasoße war ursprünglich ein Beiprodukt
Bei der Herstellung von Miso fällt aber auch eine braune, streng riechende Flüssigkeit ab. Auch diese Flüssigkeit enthält alle interessanten Geschmackskomponenten von Miso, inklusive Glutamat. Es handelt sich hierbei um Sojasoße.
Vermutlich vor etwa 1.200 Jahren entdeckte man, wie geschmackvoll Sojasoße ist.
Im sechsten Jahrhundert kam der Buddhismus mit seinem Fleischverbot in Japan an. Die japanische Aristokratie war zu diesem Zeitpunkt an den Geschmack von Fleisch und Fisch gewöhnt.
Sojasoße hatte das Potential, die adlige Küche Buddhismus-konform zu machen. Aber Sojasoße blieb für noch etwa 700 Jahre ein Luxusprodukt. Erst um das Jahr 1500 herum fand man heraus, wie Sojasoße gezielter hergestellt werden kann. Jetzt wurde Weizen bei der Fermentation zugegeben, was die Sojasoße süßer machte.
Exkurs: Glutamat, der Stoff, der die Geschmacksnerven High macht
Sowohl bei Sojasoße und Miso als auch bei Dashi und der Grundlage Katusobushi und Konbu ging es um Glutamat. Glutamat hat als Geschmacksverstärker einen schlechten Ruf. Warum eigentlich?
1908 fand der japanische Chemiker Kikunae Ikea heraus, das Glutamat der Stoff ist, der die Brühe auf der Basis von Konbu so deliziös macht. Er realisierte, dass Glutamat auch industriell hergestellt werden kann. Das Produkt ist heute als Monosodium Glutamat, kurz MSG, bekannt (nicht zu verwechseln MSG = Michael Schenker Group, die zweitweise auch als McAuley Schenker Group firmierte).
Einige Jahre später kam ein (ebenfalls japanischer) Kollege darauf, dass das IMP die Brühe auf der Basis von Bonito so wohlschmeckend macht. Inosin-Monophosphat macht jede Art von Fisch zu einer Delikatesse und entsteht immer, wenn das ATP in den Muskelzellen nach dem Tod des Fischs zersetzt wird. IMP kann ebenfalls industriell hergestellt werden. Wie MSG wird es heute als Geschmacksverstärker verwendet.
Geschmacksrichtung Umami
Lange glaubte man, dass die menschlichen Geschmacksnerven entweder süß oder salzig oder sauer oder bitter wahrnehmen würden.
Japanische Wissenschaftler fanden heraus, dass auf der menschlichen Zunge auch Rezeptoren für Umami sitzen. Diese Rezeptoren reagieren auf verschiedene Aminosäuren wie beispielsweise Glutamate und IMP.
Weil man das inzwischen weiß, wird MSG in vielen Arten von Fertigprodukten zugesetzt, inklusive Wurst- und Fleischwaren. Denn die moderne Massentierhaltung lässt wenig Raum für die Entwicklung von natürlichem Fleischgeschmack. Mit MSG kommt der Geschmack zurück in die Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Deklariert ist MSG häufig als „Hefeextrakt“ oder als „Pflanzenprotein“.
In Tomaten, vielen Käsesorten und Fisch ist Glutamat natürlich enthalten.
Wichtig für den Geschmack: Nori und Wasabi
Heute ist Sushi ohne Nori kaum denkbar. Die knusprigen grünen Blätter werden aus getrockneten und gepressten Rotalgen gewonnen. Für Sushi werden sie erst seit dem 20. Jahrhundert verwendet, und das ist einer Britin zu verdanken. Zwar aß man in Japan Berichten zufolge schon im 18. Jahrhundert die „schwarzen Blätter“ (vgl. Corson, S. 82). Aber eben nicht mit Sushi.
Das „schwarze Papier“ aus dem Meer
Nori wurde in Asakusa erfunden, einem Stadtteil des heutigen Tōkyō.
Die Rotalgen mussten wild gesammelt werden, sie konnten nicht kontrolliert gezüchtet werden. Das gelang erst nach 1950, nachdem die Britin Kathleen Drew-Baker herausgefunden hatte, wie die Algen sich vermehren. In der Ariake-See im Süden Japans steht bis heute eine Granitsäule, die ein Porträt Drew-Bakers zeigt und sie als „Mutter des Ozeans“ betitelt. Auf ihren Erkenntnissen beruht die gesamte Nori-Industrie Asiens.
Maki-Sushi wurde in Japan erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich beliebt, und das ist den amerikanischen Sushi-Kreationen zu verdanken.
Ein Hauch von Schärfe
Eine gänzlich andere Sache ist Wasabi.
Häufig als Meerrettich bezeichnet, handelt es sich dabei um eine Wurzel, die zwar mit Meerrettich verwandt ist, aber doch anders schmeckt. Wasabi ist unglaublich wählerisch und kann nur unter schwierigsten Bedingungen kultiviert werden. Deshalb ist echter Wasabi extrem teuer. Die Wurzel wird frisch gerieben und in kleinen Mengen sofort verzehrt.
Heute überwiegend günstige Ersatzprodukte verwendet
Was heute zum würzen von Sushi verwendet wird, ist eine grüne Paste aus verschiedenen Pulvern, ähnlich einer Currymischung. Die Farbe ist künstlich zugesetzt, das feine Pulver wird mit Wasser angerührt und ergibt so die Paste, die die meisten Menschen als Wasabi kennen. Geschmacklich hat das mit dem echten Wasabi fast nichts zu tun.
Und anders als die meisten Menschen glauben ist Wasabi auf Fisch auch nicht antibakteriell. Wasabi tötet keine Erreger oder Parasiten.
Aber Wasabi schafft im Magen Konditionen, die für Erreger einfach nur lebensfeindlich sind. Präventiv gegen Lebensmittelvergiftung ist Wasabi also durchaus eine sinnvolle Sache (vgl. Corson, S. 161). Wasabi wird in Japan etwa seit dem 10. Jahrhundert genutzt.
Frischen Wasabi in München probieren
Wasabi lässt sich nur in Japan richtig gut kultivieren – es wird eine ganz spezielle Mischung zwischen Sonne, Schatten, frischem Wasser und Mineralien im Wasser benötigt.
Auch die Handhabung des frischen Wasabi ist nicht ganz einfach.
Bei uns im Restaurant sansaro in München können Sie immer wieder frischen Wasabi probieren. Das empfehlen wir besonders zum Sashimi. Fragen Sie die Servicemitarbeiter danach, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Appendix: verwendete Quellen und weiterführende Informationen
https://www.mizkan.co.jp/sushilab/manabu/0.html
https://rekishi-memo.net/japan_column/sushi.html
https://sushi-all-japan.com/index_b2_1.html
https://1200irori.jp/content/learn/detail/case17
https://jpnculture.net/sushi/
https://gogonihon.com/de/blog/japanisches-sushi/
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von jpnfood.com zu laden.
https://www.pbs.org/food/the-history-kitchen/history-of-sushi/
https://www.japandigest.de/kulturerbe/geschichte/geschichte/yayoi-zeit/
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.rokaakor.com zu laden.
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%89%8D%E9%AE%A8%E8%81%B7%E4%BA%BA%E3%81%8D%E3%82%89%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von cuisine-kingdom.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von cuisine-kingdom.com zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von cuisine-kingdom.com zu laden.
https://www.sushi-guide-morita.de/index_jp.html
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von antikewelt.de zu laden.
Buruma, Ian: Japan hinter dem Lächeln. Götter, Gangster, Geishas. Ullstein Taschenbuch, Frankfurt am Main 1988
Corson, Trevor: The Story of Sushi. An Unlikely Saga of Raw Fish and Rice. Harper Perennial, New York 2008.
Hadamitzky, W.; Spahn, M.; Putz, O., Arnold-Kanamori, H. u. a.: Langenscheidts Großwörterbuch Japanisch-Deutsch. Zeichenwörterbuch. Langenscheidt, Berlin und München 1997
Ienaga, Saburō: Kulturgeschichte Japans. Iudicium Verlag, München 1990
Issenberg, Sasha: The Sushi Economy. Globalization and the Making of a Modern Delicacy. Gotham Books, published by Penguin Group, London 2007
Marra, Michael F.: A History of Modern Japanese Aesthetics. University of Hawai’i Press, Honolulu 2001
Naumann, Nelly: Die Mythen des alten Japan. Anaconda Verlag, München 2020
Tomiyama, Yoshimasa; Miura, Yukio; Yamaguchi, Kazuo:Ikubundo japanisch-Deutsches Wörterbuch. Ikubundo Verlag, Tokyo 1996






